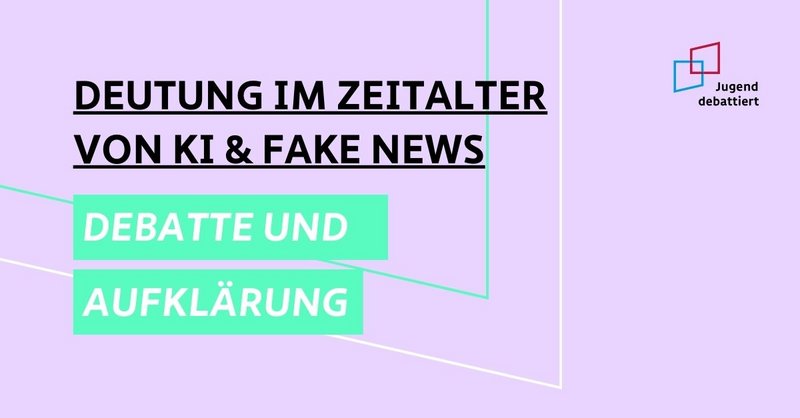Jugend debattiert News
Debatte und Aufklärung: Was können wir der Anti-Aufklärung entgegensetzen?
Die Prinzipien unserer Demokratie wurzeln in den Ideen der Aufklärung. Welche Bedeutung haben die Werte Freiheit, Gleichberechtigung und Toleranz heute? Mit dieser Frage befasst sich das Deutsche Historische Museum Berlin am 21. März beim Festival „Aufklärung now“ aus der Perspektive von jungen Menschen. Jugend debattiert wird sich mit einer Schaudebatte beteiligen. Welche Rolle Debatten in aufgeklärten Gesellschaften spielen, das beleuchten wir im Vorfeld in einer dreiteiligen Serie.
Teil 3: Fake News und autoritäre Glaubenssätze – Was können wir der Anti-Aufklärung entgegensetzen?
Interview mit der Philosophin Marie-Luisa Frick
Die aufgeklärte Debatte ist ein Fundament unserer Demokratie. Wie bedroht ist sie heute durch Anti-Aufklärung?
„Die Begriffe ‚aufgeklärt‘ und ‚Anti-Aufklärung‘ legen nahe, dass klar zwischen Aufklärung und ihrem Gegenteil unterschieden werden kann. So einfach ist das aber weder mit Blick auf die Epoche, die wir Aufklärung nennen, noch gegenwärtig. Was eine aufgeklärte Debatte ist und was sie bedroht, ist selbst Gegenstand von Kontroversen. Vereinfacht gesagt: Für die eine Seite sind ‚Cancel Culture‘ und ‚Wokeness‘ das Gegenteil einer aufgeklärten Debatte, für die andere Seite ‚Hetze‘ und ‚Fake news‘. Beide Positionen haben nicht völlig Unrecht, wenn sie einerseits freie, unzensierte Rede als Ausdruck aufgeklärter Debatten verstehen, andererseits aber auch den nötigen Respekt für das Gegenüber einmahnen und vor gezielter Desinformation warnen. Dass es zur scheinbaren Unversöhnlichkeit dieser Positionen gekommen ist, ist ein bedauerliches Resultat von Polarisierung und Missverständnissen.
Aufgeklärte Debatten sind für mich solche, die der Erkenntnissuche dienen, die das Verstehen-wollen an den Anfang setzen, nicht das Siegen über Andersdenkende oder gar die Manipulation. Eine Debatte, aus der alle Beteiligten im besten Fall klüger herausgehen, ist gekennzeichnet von aktivem Zuhören und echtem Interesse am Anderen. Das ist leider selten der Fall, umso mehr sollte man gute Gespräche, auch robuste Kontroversen auf Augenhöhe schätzen.“
Welche Rolle spielen Medien dabei?
„Sowohl klassische, allen voran öffentlich-rechtliche, aber auch neue Medien haben eine wichtige Rolle dafür, wie wir miteinander sprechen und wie wir übereinander denken. Das allermeiste, das wir von der Welt zu wissen glauben, ist medial vermittelt. Wir sind also abhängig von jenen, die uns informieren, oftmals aber bloß unterhalten oder von Wesentlichem ablenken. Deshalb ist es wichtig, Medien – und zwar ausnahmslos alle – kritisch zu konsumieren und keine einseitige ‚Medien-Diät‘ zu praktizieren. Besonders wachsam sollte man sein, wenn man selbst merkt, dass bestimmte Formate stark emotionalisieren. Da kann man sich ruhig fragen: Will hier jemand, dass ich etwas Bestimmtes denke oder tue? Werden mir klare Feindbilder vermittelt und Schlussfolgerungen vorgekaut? Kurzum: Will jemand die Kontrolle über meinen Kopf und wozu? Diese Kontrolle sollte man, im Sinne des Anspruches der Aufklärung, nie ganz aus der Hand geben. Und doch müssen wir grundsätzlich fähig sein, Vertrauen zu leihen – das ist die Schwierigkeit, vor der wir alle stehen.“
Die Erfahrungen während der Corona-Pandemie haben das Vertrauen bei vielen erschüttert. Zugleich wurde deutlich, dass Wissenschaft häufig zu komplex ist, um von allen selbst denkend verstanden zu werden. Wie ließe sich das Problem der zunehmenden Komplexität lösen?
„Die angesprochene Schwierigkeit, einerseits skeptisch zu sein, anderseits nicht völlig misstrauisch, spielt hier hinein. Die Pandemie hat auch gezeigt, dass die meisten weder völlig misstrauisch noch völlig leichtgläubig sind. Vielmehr waren bzw. sind sie einseitig (miss-)trauisch und zwar denen gegenüber, die sie für das eigene bzw. fremde Lager halten. Dann gibt es plötzlich die Expert:innen der einen, jene der anderen Seite. Dass Wissenschaftler:innen als unabhängige Autoritäten wahrgenommen werden können, ist essenziell. Es liegt auch in ihrer Verantwortung, diese Unabhängigkeit zu schützen. Sie müssen nicht nur in der Lage sein, Komplexes auf den Punkt zu bringen, ohne zu verfälschen, sondern auch ohne Lenkungsabsichten mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Wer lenken will, verschweigt, übertreibt oder redet klein. In diesem Sinne redliche Wissenschaft verdient Achtung und Dank, denn seit der Aufklärung ist der wissenschaftliche Geist der große Wohltäter der Menschheit. Ob das so bleibt, hängt nicht nur vom Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik bzw. Wissenschaft und Bevölkerung ab, sondern auch von der Selbsterneuerung der Wissenschaften angesichts der wachsenden Komplexität an allen Fronten.“
Wie können die Prinzipien der Aufklärung in unserer Debattenkultur gestärkt werden?
„Dazu müssen, wie gesagt, diese Prinzipien erst einmal ausbuchstabiert und zur Diskussion gestellt werden, da verschiedene Menschen Unterschiedliches darunter verstehen. Mein Vorschlag wäre, Debatten konkret unter zwei Prinzipien zu stellen, die dem Denken der Aufklärung entnommen werden können: Zum einen das Prinzip der Kritik oder des kritischen Denkens, zum anderen das humanistische Prinzip. Menschen, die kritisch denken gelernt haben, fordern Begründungen für Thesen ein und Belege für Behauptungen. Sie nehmen also nicht einfach alles so an, wie es ihnen offeriert wird. Das erhöht den Druck auf das Gegenüber, welches vielleicht auf Irrtümer oder Kurzschlüsse im eigenen Denken stößt.
Wenn aber nun Gehässigkeit und Geringschätzung dominieren, wird niemand Fehler offen eingestehen. Eine gute Debatte benötigt wesentlich eine Grundhaltung des Respekts: die Anerkennung des Anderen als Menschen, egal wer er oder sie als Individuum ist. Für diesen Respekt gibt es verschiedene Quellen. Eine, die alle ‚anzapfen‘ können, ist das Bewusstsein unserer geteilten Verletzlichkeit und Unvollkommenheit. Einfach gesagt: Es steht Menschen besser an, freundlich zueinander zu sein, als arrogant. Es ist wichtig, Debattenkultur von Jugend an zu erlernen. Kultur ist schließlich nichts, was ein Einzelner in der Hand hat, sie lebt durch uns alle. Und sie lebt vor allem über Generationen hinweg – wenn sie denn lebt.“
Marie-Luisa Frick ist stellvertretende Leiterin des Instituts für Philosophie an der Universität Innsbruck. Im Reclam Verlag hat sie in der Reihe „Was bedeutet das alles?“ die Bücher „Mutig denken. Aufklärung als offener Prozess“ (2020) und „Zivilisiert streiten. Zur Ethik der politischen Gegnerschaft“ (2017) veröffentlicht.
Das „Aufklärung Now“-Festival im Deutschen Historischen Museum in Berlin findet am 21. März 2025 von 17 bis 23 Uhr statt. Junge Menschen präsentieren dort ihre Perspektiven auf die Aufklärung. Die Schaudebatte von Jugend debattiert wird die Frage verhandeln, ob der Staat in seiner Außendarstellung Bezüge auf das Zeitalter der Aufklärung minimieren soll. Der Eintritt ist frei.