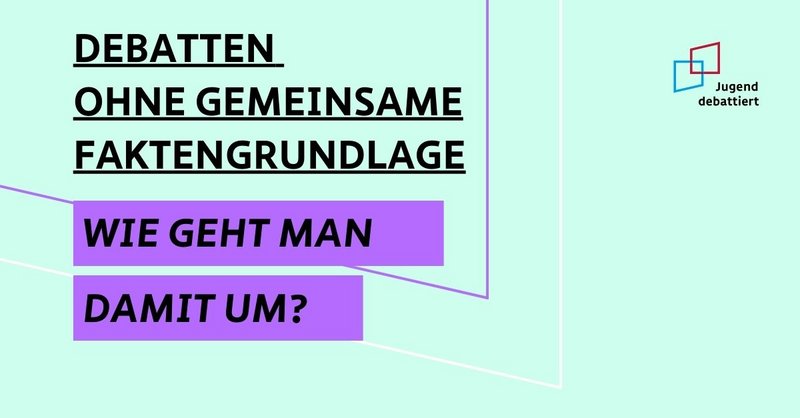Jugend debattiert News
Fake Facts in Debatten: Wie geht man damit um?
Politische Debatten zu führen, Argumente auszutauschen und sich über komplexe Fragen zu streiten sind die Grundlage unserer Demokratie. Aber wie funktioniert das, wenn Mitstreitende sich auf alternative Fakten berufen, Desinformation verbreiten und Gesprächsregeln negieren? Diese Frage stellt sich zunehmend im politischen Diskurs und auch in Talkshows. Vor der Bundestagswahl sind Partei-Vertreterinnen und -Vertreter in verschiedenen TV-Formaten zu Gast. Greta Wonneberger, freie Trainerin bei Jugend debattiert, gibt im Jugend debattiert-Interview Tipps für Debatten ohne gemeinsame Faktengrundlage.
Warum ist eine gemeinsame Grundlage an Fakten und Werten für das Debattieren wichtig?
„Wenn wir uns darüber einig sind, was eine seriöse Quelle, aussagekräftige Fakten und vertretbare Werte sind, können wir in Debatten gemeinsam vergleichen, abwägen und gewichten. So kommt Fortschritt im Gespräch zustande, auch ohne Einigung. Denn für das Publikum und uns selbst wird geklärt, wo genau Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Blick auf die Sache bestehen. Wenn diese Ausgangslage nicht gegeben ist, kommen wir inhaltlich nicht voran. Dann tritt die Show in den Vordergrund.“
Wann und warum lohnt es sich, Debatten zu führen, auch wenn diese Grundlage fehlt?
„Debatten lohnen sich dann, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind: Erstens, unser Gegenüber ist bereit, übergeordnete Gesprächsregeln zu beachten, also auf Beleidigungen und unnötige Unterbrechungen zu verzichten und inhaltlich Bezug auf unsere Beiträge zu nehmen. Zweitens, wir sehen uns selbst in der Lage, die Herausforderung anzunehmen, weil wir gut genug informiert und vorbereitet sind und emotional stabil. Wenn eine oder beide Voraussetzungen nicht erfüllt sind, empfiehlt es sich, zunächst die Regeln des Gesprächs abzuklären oder das Gespräch zu beenden.“
Was kann man Aussagen, die auf Falschnachrichten basieren, am besten entgegensetzen?
„Unser erster Impuls ist natürlich, die Falschnachrichten richtig zu stellen. Vor allem dann, wenn wir sicher sind, die korrekten Fakten und Zahlen zu kennen. Das ist jedoch nicht immer der Fall, und selten lassen sich diejenigen, die falsche Nachrichten verbreiten, auf solche Korrekturen ein. Deshalb kann es auch ein gutes Ziel sein, die Falschnachrichten für andere, die der Debatte folgen, aufzudecken, indem wir kritisch fragen, woher eine Information stammt zum Beispiel. Wichtig dabei ist, jeweils nur eine Frage zu stellen und ihre Beantwortung wirklich abzuwarten. Die Antwort können wir paraphrasierend festhalten. Danach heißt es: Weiter geht’s! Wir sollten uns an einer Falschnachricht nicht zu lange festbeißen und sie damit weiter verbreiten. Stattdessen können wir neue Aspekte des Themas aufgreifen, um die unterschiedlichen Positionen weiter zu entfalten.“
Sollte man in so einer Situation versuchen, das Gegenüber zu überzeugen?
„Nein, in Debatten werden wir unser Gegenüber nur selten völlig überzeugen. Andersherum wollen wir unsere Position ja ebenfalls nicht einfach aufgeben. Aber es gibt auch andere gute Ziele beim Debattieren, wie das Gegenüber nachdenklich zu machen oder auch für andere, die zuhören, aufzeigen, dass es eine Gegenposition gibt. Das kann gelingen, wenn wir zuhören, konsequent an das Gegenüber anknüpfen und den Überblick behalten, Argumente stichhaltig aufbauen, gut informiert sind und klar formulieren.
Die Bundestagswahl ist nur noch 10 Tage entfernt und die in Teilen rechtsextreme AfD liegt in den Umfragen unverändert bei 20 Prozent. Gleichzeitig geht man beim Meinungsforschungsinstituts Forsa davon aus, dass sich mindestens ein Viertel der Wahlberechtigten noch gar nicht entschieden hat. Es kann sich also durchaus lohnen, die ein oder andere Debatte noch zu führen.“